BRS News
Rotes Fleisch - ein wichtiger Partner bei der Reduktion der globalen Treibhausgasemissionen
Wissenschaftliche Arbeiten in Australien haben in einem Programm mit dem Titel Carbon Neutral 2030
die Möglichkeit einer kohlenstoffneutralen Rotfleischindustrie aufgezeigt. Hierbei werden Optionen kombiniert, um die Methanemissionen von Wiederkäuern deutlich zu reduzieren. Die Forschung hat die Schlüsselrolle von neuartigen Futterergänzungsmitteln, anti-methanogenen Hülsenfrüchten und mikrobieller Manipulation im Pansen identifiziert. Futterergänzungsmittel für Wiederkäuer wie marine Makroalgen (Asparogopsis spp.) in geringen Mengen könnten die Methanemissionen in landwirtschaftlichen Systemen mit verbesserter Produktivität und ohne nachweisbare Auswirkungen auf die Tiergesundheit oder die Fleischqualität erheblich mindern. Die wirtschaftliche Analyse untersucht die Produktivität und das Kohlenstoffvermeidungspotenzial für eine Reihe von Strategien zur Methanverringerung. Das National Livestock Methane Program (NLMP) in Australien lief von 2009 bis 2016 und untersuchte die Wirksamkeit einer Reihe von Strategien zur Verringerung der Methanemissionen von Wiederkäuern (MLA 2016).
Kompetenzzentrum Weidetierhaltung gegründet
Landwirtschaftliches Wochenblatt (Alina Schmidtmann) - Der Wolf gefährdet die Existenz vieler Weidetierhalter. Deshalb hat der Bundestag das Kompetenzzentrum Weidetierhaltung gegründet. In der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2021 gaben die Parlamentarier 300.000 Euro für ein solches Zentrum bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) frei. Tierhalter sind mit dem Ergebnis aber nicht zufrieden.
Mexiko steigert Viehexporte in die USA
Zwischen September 2019 und Ende August 2020 ist der Rinderexport in die USA angestiegen, informiert der amerikanische National Service of Health, Safety and Agrifood Quality (Senasica). Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 1.392.836 Rinder über die Grenze geschickt, 55.209 Rinder mehr als in der Vermarktungsperiode 2019. Außerdem hat Mexiko in den ersten acht Wochen des Zyklus 2020-2021 193.704 Stück Lebendvieh exportiert (+40%).
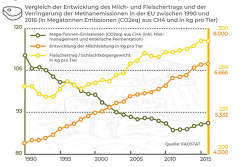
Wenn alle Menschen Veganer würden, könnten wir über eine drastische Reduktion der Viehbestände den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) deutlich verringern? Dies sind Fragen, mit denen sich Dr. Sara Place in ihrer Arbeit als Chief Sustainability Officer von Elanco Animal Health auseinandersetzt. Auf dem virtuellen Food and Nutrition Forum von Farm & Food Care diskutierte sie die Auswirkungen der Viehzucht auf die Umwelt und den Klimawandel. Einer der größten Kritikpunkte an der Viehzucht sei die Vorstellung, dass Nutztiere Lebensmittel verbrauchen, die Menschen ernähren könnten. Doch wenn es um Ressourcenkonkurrenz geht, sagt Place, dass nur 14 Prozent der weltweiten Tierrationen vom Menschen verzehrt werden könnten - 86 Prozent des Tierfutters passen laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen nicht auf unseren Teller. Place stellte fest, dass Tiere auch hocheffiziente Futterverwerter sind - Rinder brauchen nur 0,6 kg Futterprotein, um 1 kg Protein im tierischen Leistungsprodukt zu erzeugen. Die Viehzucht steigert die Effizienz weiter; seit 1975 ist die für den Anbau von Nutzpflanzen für die Viehzucht benötigte Fläche in den USA um 26 Prozent geschrumpft, während die gesamte Fleischproduktion deutlich zugenommen hat. Die Viehzucht in den USA ist für vier Prozent der THG-Emissionen verantwortlich. Auf der Grundlage von Forschungsergebnissen der National Academy of Sciences aus dem Jahr 2017 sagt Place, wenn jeder Amerikaner eine vegane Ernährung einführen würde, würden die Treibhausgase in den USA nur um 2,6 Prozent oder 0,36 Prozent der globalen Emissionen reduziert. Zwar wird der Verzicht auf tierisches Eiweiß den Planeten nicht retten, aber es gibt Möglichkeiten, den ökologischen Fußabdruck der Viehzucht zu verringern. Place stellt fest, dass Studien darauf hinweisen, dass die Treibhausgasemissionen des Viehzuchtsektors durch kontinuierliche Verbesserungen in den Bereichen Tiergenetik, Fütterungsprogramme, Tiergesundheit sowie Dung- und Weidemanagement um weitere 30 Prozent gesenkt werden könnten.
Der Freistaat Bayern unterstützt Zuchtsauenhalter und Milchviehbetriebe, die in tierwohlgerechtere Ställe investieren, im kommenden Jahr kraftvoll. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat mitgeteilt, dass für diese beiden Bereiche der Zuschusssatz im Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP) auf 40 Prozent erhöht wird. Damit schöpfen wir das Maximum aus, mehr ist nach EU-Beihilferecht nicht möglich. Unser Ziel ist klar: Die Ställe der Zukunft sollen in Bayern stehen
, sagte die Ministerin. Bei den Milchviehbetrieben geht es um die Umstellung von Anbindehaltung auf Laufstallhaltung. Mit der Förderung von Laufställen in der Milchviehwirtschaft zeigen wir, dass wir die zunehmend kritische Einstellung der Öffentlichkeit und der Vermarkter gegenüber der Anbindehaltung von Milchkühen ernst nehmen
, sagte Michaela Kaniber.
Das seit Juli 2019 laufende Projekt FleQS ist neben den Projekten FoKUHs in Österreich und FLECKfficient in Baden-Württemberg das dritte große Kuhlernstichproben-Projekt beim Fleckvieh. Die Genotypen und Phänotypen der Projektkühe ermöglichen es, die genomischen Zuchtwerte sicherer zu schätzen. Dies gilt sowohl für die üblichen Merkmalsspektren als auch für neue Merkmale aus den Bereichen Gesundheit, Klauenpflege und Tierverhalten. FleQS basiert auf zwei Säulen: dem Bullenmodell
und dem Betriebsmodell
. Während beim Bullenmodell eine Zufallsstichprobe von Töchtern aller bayerischen Besamungsbullen genotypisiert und mit den Standardmerkmalen in die Lernstichprobe eingebracht wird, werden in den Projektbetrieben im Betriebsmodell zusätzlich auch Daten zu neuen Merkmalen aus den Bereichen Gesundheit, Klauenpflege, Tierverhalten und Kälberkrankheiten erfasst.
Was verbirgt sich eigentlich hinter Blockchain
und welchen Nutzen hat die Landwirtschaft davon? Das IT-Tinanzmagazin versucht sich an einer Übersetzung, die leicht verständlich ist. Übertragen auf die Landwirtschaft kann man den Nutzen z.B. am Beispiel zur digitalen Abwicklung von Blühpatenschaften nachvollziehen. Die BayWa AG hat hierfür eine Anwendung programmieren lassen. Als Pate landwirtschaftlicher Blühflächen können Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen bereits ab 1 Euro einen Beitrag zu mehr Artenvielfalt und Insektenschutz leisten. Die Blockchain-Technologie im Hintergrund reduziert dabei den Organisationsaufwand: Alle durchgeführten Transaktionen werden automatisiert verarbeitet, Projektfortschritte, Blühstatus oder auch Zahlungsabläufe werden transparent dokumentiert und auf der Internetplattform combayn.de abgebildet. Durch die geografische Verortung der Blühflächen können Blühpaten außerdem gezielt Blühflächen in ihrer Region fördern. Was hängen bleiben sollte: Die Bedeutung transparenter Wertschöpfungsketten wird weiter zunehmen – auch in der Landwirtschaft
.
Point 221/2020 - Die globalen Bestrebungen zur Entwicklung von COVID-19 Impfstoffen haben innerhalb von weniger als einem Jahr eine erstaunliche Zahl vielversprechender Kandidaten hervorgebracht - ein Rekordtempo, das wohl noch im Jahr zuvor kaum jemand für möglich gehalten hätte. Die WHO zählt in ihrer aktuellen Zusammenstellung vom 12. November 2020 164 Impfstoffe in der präklinischen Evaluation, und bereits 48 Kandidaten in der klinischen Prüfung. Darunter befindet sich auch der vielversprechende Impfstoff des kanadisch/US-amerikanischen Unternehmens Medicago. Er besteht aus virusähnlichen Partikeln(«virus-like particles», VLP), die in Pflanzen produziert werden (siehe POINT 214,März 2020). Vorteile einer Impfstoffproduktion in Pflanzenzellen sind der potentiell schnellere Produktionsbeginn, niedrigere Produktionskosten und eine bei Bedarf mögliche raschere Steigerung des Produktionsvolumens im Vergleich zur Produktion in tierischen Zellkulturen. Ausserdem ist die Gefahr einer Verunreinigung durch menschliche Krankheitserreger deutlich niedriger. Auf der WHO-Kandidatenliste finden sich drei weitere in Pflanzen produzierte Impfstoff-Kandidaten, die im Moment in der präklinischen Prüfung stehen.
Point 221/2020 - CRISPR/Cas9 und andere moderne Verfahrender Genomeditierung haben auch in der Pflanzenzüchtung einen Innovationsschub ausgelöst. Neben einer immer weiter steigenden Zahl wissenschaftlicher Artikel erscheinen zunehmend auch Übersichtsartikel in den Fachzeitschriften, welche Entwicklungen in bestimmten Gebieten beleuchten. Auch ein vor kurzem vorgelegter Bericht der ALLEA, dem europäischen Dachverband der Wissenschaftsakademien mit über 50 Mitgliedsakademien aus über 40 Ländern, kommt zum Schluss, dass auf politischer Ebene Handlungsbedarf besteht. Das Genome Editing bietet grosse Chancen für Landwirtschaft, Gesellschaft und die Umwelt, aber auch zahlreiche Herausforderungen. Während aus Sicht der Wissenschaft von genomeditierten Pflanzen mit Veränderungen, die auch spontan in der Natur entstehen können, keine speziellen Risiken ausgehen, werden derartige Pflanzen aufgrund des EuGH-Urteils von 2018 als streng regulierte GVO eingestuft. Dadurch werden Forschung und eine mögliche Anwendung stark eingeschränkt. Erschwert wird die Situation durch die fast nicht mögliche Rückverfolgbarkeit genomeditierter Pflanzen aufgrund fehlender Nachweismöglichkeiten. Der ALLEA-Bericht schliesst, dass der gegenwärtige europäische Rechtsrahmen für genomeditierte Pflanzen untauglich ist und fordert Reformen – ein Beibehalten des Status Quo sei keine Option. Der Bericht präsentiert verschiedene Handlungsoptionen mit ihren Vor-und Nachteilen. Besonders wichtig sei eine internationale Koordinierung der Regulierungsansätze.
Der Thünen Report 82 beschreibt die erwarteten Entwicklungen auf den Agrarmärkten bei einer Beibehaltung der derzeitigen Agrarpolitik und Umsetzung bereits beschlossener Politikänderungen unter bestimmten Annahmen zur Entwicklung exogener Einflussfaktoren. Dabei beruhen die Berechnungen auf Daten und Informationen, die bis Februar 2020 vorlagen. Dargestellt werden Projektionsergebnisse für Agrarhandel, Preise, Nachfrage, Produktion, Einkommen und Umweltwirkungen. Die Darstellung der Ergebnisse konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklungen des deutschen Agrarsektors im Vergleich zur Situation im Basisjahrzeitraum 2017-2019. Mit Blick auf die Entwicklung im Fleischsektor lassen höhere Umwelt- und Tierwohlstandards erwarten, dass sich das Produktionswachstum der vergangenen Jahre abschwächt, insbesondere in der Schweinefleischerzeugung, wohingegen die Geflügelfleischerzeugung bis zum Jahr 2030 noch leicht wächst. Stabile Milchpreise und Milchviehbestände in Verbindung mit einer weiteren Steigerung der Milchleistung führen außerdem zu einem moderaten Anstieg der Milchanlieferungen. Das durchschnittliche reale Einkommen landwirtschaftlicher Betriebe entwickelt sich über die Produktionsperiode rückläufig, erreicht im Jahr 2030 aber immer noch das mittlere Niveau der letzten zehn Jahre.














